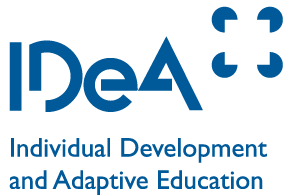Projekt CLaB
Child Language Brokering – Perspektiven von Lehrenden und Lernenden auf eine translinguale Alltagspraktik
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt CLaB untersucht systematisch das Phänomen des Child Language Brokering (CLB) – also informelle Übersetzungshandlungen mehrsprachiger Schüler*innen – im deutschsprachigen Schulkontext. In drei Teilstudien werden Perspektiven von Kindern und Lehrkräften auf CLB, dessen interaktionale Muster sowie didaktisches Potenzial erhoben und analysiert. Ziel ist es, gemeinsam mit den Beteiligten Ansätze für eine translinguale Didaktik zu entwickeln und für die schulische Praxis nutzbar zu machen.
Mehrsprachigkeit gehört für viele Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte zum Alltag – auch in der Schule. Oft wird sie jedoch nicht als Ressource, sondern als Herausforderung wahrgenommen. Dabei zeigen sich im Schulalltag vielfältige informelle Strategien, wie Kinder mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen einander unterstützen. Eine dieser Strategien ist das sogenannte Child Language Brokering (CLB): Mehrsprachige Schüler*innen übersetzen dabei spontan und informell für Mitschüler*innen mit geringeren Deutschkenntnissen – zum Beispiel bei Arbeitsaufträgen, im Austausch mit Lehrkräften oder in alltäglichen Gesprächen. Diese Vermittlungsprozesse werden bislang im deutschsprachigen Raum kaum erforscht, obwohl sie eine wichtige Rolle im Schulalltag spielen.
Hier setzt unser Projekt an: In enger Zusammenarbeit mit Kindern und Lehrkräften erfassen wir, wann und wie CLB stattfindet, wie es von den Beteiligten wahrgenommen wird und welches Potenzial darin für das gemeinsame Lernen liegt. In drei Teilstudien beleuchten wir CLB aus erziehungswissenschaftlicher, sprachwissenschaftlicher bzw. -didaktischer und professionsbezogener Perspektive. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für diese Praxis zu entwickeln und daraus Anregungen für eine translinguale Didaktik abzuleiten – also für eine Didaktik, die Mehrsprachigkeit als Ressource nutzt. Langfristig sollen daraus praxisnahe Fortbildungskonzepte entstehen, die Schulen im Umgang mit sprachlicher Vielfalt unterstützen.

Ausgewählte Publikationen
- David-Erb, M. (2024). Sprache und Raum in non-formalen Bildungssettings: Perspektiven junger Geflüchteter auf ihre mehrsprachigen Lebenswelten. In C. Röhner, J. Schwittek & A. Potsi (Hrsg.), Transmigration und Place-making (S. 293–310). Barbara Budrich.
- Geyer, S. & Schastak, M.(eingereicht). Sprachvergleiche – Eine geeignete Methode im Grammatikunterricht in der Grundschule? Empirische Erkenntnisse zu den Überzeugungen und Praktiken von Lehrkräften. Zeitschrift für Grundschulforschung.
- Schastak, M., David-Erb, M. & Geyer, S (eingereicht). „…and that makes multilingualism almost difficult.” A mixed methods study on the attitudes and practices of teachers and parents regarding multilingualism in different contexts.
Kooperationen